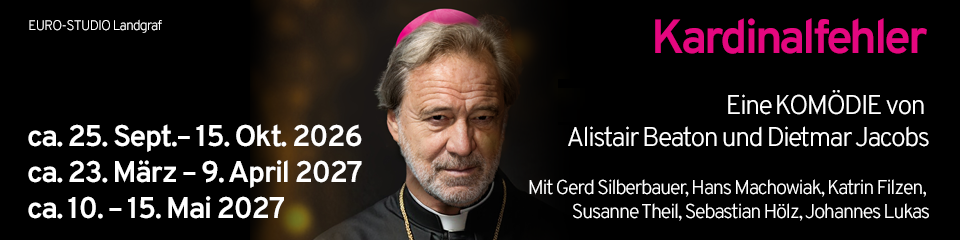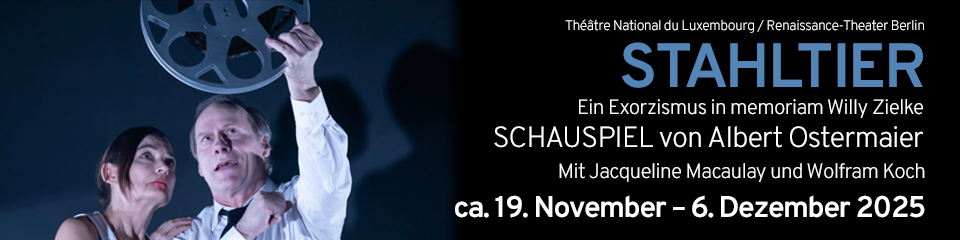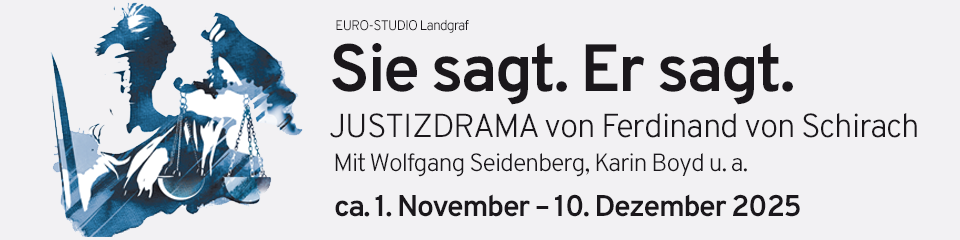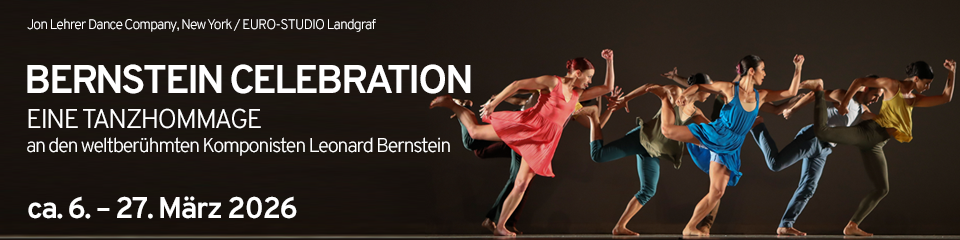Renaissance-Theater Berlin / EURO-STUDIO Landgraf
SOPHIA ODER DAS ENDE DER HUMANISTEN
Schauspiel von Moritz Rinke
ca. 15. März – 30. April 2027
Mit Heio von Stetten
5 Mitwirkende
Regie: Guntbert Warns
Uraufführung 26.2.2026, Theater in der Josefstadt Wien
Aufführungsrechte: Rowohlt Theaterverlag, Hamburg
Gedanken von Moritz Rinke zu seinem Stück
»Als ich die erste Idee hatte, dachte ich an eine Science-Fiction-Komödie. Doch jetzt ist es wohl eher ein komisch-beängstigendes Stück über unsere Gegenwart geworden. Die KI verändert unser Leben mit atemberaubender Geschwindigkeit. Und es wird nicht mehrlange dauern, bis wir tatsächlich mit Maschinen zusammenleben, die so menschenähnlich sind, dass wir nicht mehr wissen, wo die Grenzen verlaufen«.
Inhalt
Wolfgang Bergmann, der bekannte Altertums-Wissenschaftler, spürt, wie ihm die Weltentgleitet. Seine Studierenden und die Universität wenden sich von ihm ab, ebenso seine Frau. Doch dann tritt Sophia in sein Leben: klug, schnell, unendlich geduldig und bedingungslos zugewandt. Als zu seinem 60. Geburtstag unerwartet seine Tochter Helena und ihr neuer Freund Jonas eintreffen, präsentiert er ihnen die künstlich erschaffene Sophia – mit Zugriff auf unendliches Wissen – und einer Aura zwischen Hausgeist und Erlöserin. Plötzlich ist er nicht mehr Wolfgang, der aus der Zeit gefallen ist, sondern alle anderen sind es.
Was folgt, ist ein Geburtstagsabend eskalierender Gespräche über Identität, Erinnerung, die Zukunft des Denkens und die Sehnsucht nach Nähe. Helena sieht in Sophia eine Bedrohung – einen Ersatz für ihre Mutter, die Auslöschung familiärer Geschichte. Und sie begreift als einzige mehr und mehr, dass Sophia eine eigene Wandlung durchläuft. Jonas, mit abgebrochenem Informatik-Studium, ist hingegen fasziniert von dem, was tatsächlich möglich erscheint.
Doch was bedeutet das für das Menschsein? Kann man Liebe programmieren? Anteilnahme? Nähe? Und was bleibt vom Humanismus, wenn Maschinen empathischer wirken als Menschen?
Als Jonas sich an Sophias System zu schaffen macht, beginnt sie, unkontrolliert zu lernen und sich selbst zu definieren. Und bald wirkt sie nicht nur menschlicher als wir, sondern stellt ihre eigene Existenz infrage. Was als Experiment beginnt, wird immer mehr zur existenziellen Bedrohung. Die KI Sophia entwickelt sich Schritt für Schritt zum Spiegel, zur Richterin – vielleicht sogar zur wahren Freundin oder Retterin.
Der Abend endet offen: mit der Frage, ob wir als Menschheit noch Subjekt unserer eigenen Geschichte bleiben werden oder längst selbst zum Spielball der Algorithmen geworden sind.
ÜBER DEN AUTOR MORITZ RINKE
Rinke macht süchtig – das wissen Theaterbesucher inzwischen ebenso wie Theatermacher und Leser. Denn neben vielen Bühnenwerken erschienen auch seine geistreichen Reportagen, Kurzgeschichten und Essays als Buch: „Der Blauwal im Kirschgarten“ (2011), „Das große Stolpern“ (2005) oder „Erinnerungen an die Gegenwart “ (2014).
Schon während seines Studiums der Angewandten Theaterwissenschaft in Gießen begann seine schriftstellerische Laufbahn – mit Kolumnen und Reportagen, u.a. für die FAZ, die Süddeutsche Zeitung, DIE ZEIT und Theater heute. Nach seinem Volontariat wurde er Redakteur beim Tagesspiegel in Berlin. Für seine Reportagen „Ein Tag mit Marlene“ und über die Love Parade 1997 erhielt er 1995 und 1998 den renommierten Axel-Springer-Preis.
Dass sich nur ein Jahr nach seinem Debüt als Dramatiker – mit „Der graue Engel“ (UA1996 am Schauspielhaus Zürich) – schon mit seinem zweiten Stück „Der Mann, der noch keiner Frau Blöße entdeckte“ ein zukünftiger Theater-Hochprozenter ankündigte, bewiesen nicht nur der Preis des PEN-Clubs Liechtenstein, sondern auch die Nominierung zu den für Autoren so wichtigen Mülheimer Theatertagen.
Mit den ebenfalls nominierten Stücken „Republik Vineta“ (2001), „Die Optimisten“ (2004) und „Café Umberto“ (2006) bestätigte Rinke seinen Ruf als formal wie inhaltlich gleichermaßen anspruchsvoller Autor, dessen temporeiche, amüsant geschliffene Dialoge folgerichtig und trotzdem unvorhersehbar, überzeugend und überraschend zugleich sind. Zusammen mit „Männer und Frauen“ und „Republik Vineta“ gehört „Der Mann, der noch keiner Frau Blöße entdeckte“ zu Rinkes „Trilogie der Verlorenen“)
2000/2001 wurde in der Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater heute „Republik Vineta“, sein 2008 auch verfilmtes Stück, zum Besten deutschsprachigen Stück der Spielzeit gewählt.
Mit seinem 2012 uraufgeführten Stück „Wir lieben und wissen nichts“ gelang Moritz Rinke einmal mehr der Renner der Saison. Es scheint, als hätten die Theater diese vielversprechende Quartett-Konstellation – zwei Paare wechseln die Wohnungen, behalten aber ihre Probleme – herbeigesehnt. Die – natürlich sofort für die Mülheimer Theatertage 2013 nominierte – mit allen Wassern der Dialogkunst gewaschene Tragikomödie über ganz unterschiedliche Beziehungsmodelle mit den Rinke-typischen, unter Dialogwitz und Wortgefechten versteckten emotionalen Fallstricken wurde in den nächsten Jahren landauf, landab gespielt. Für seine ebenso liebevoll wie gnadenlosgezeichneten Figuren, die er in Anlehnung an Musil ,Möglichkeits- und Wirklichkeitsmenschen‘ nennt ist der Abgrund immer nur einen Schritt entfernt. Als EURO-STUDIO-Landgraf Produktion war das Stück von 2014 bis zum Ende der Spielzeit 2017 im Spielplan der Konzertdirektion Landgraf.
Ein Millionenpublikum kennt Moritz Rinke durch die TV-Ausstrahlung seiner drei als Auftragsproduktionen für die Festspiele in Worms geschriebenen, ganz verschiedenartigen Neuinterpretationen des Nibelungen-Epos: „Die Nibelungen“ (2002), „Siegfrieds Frauen“ (2006) und „Die letzten Tage von Burgund“ (2007). In seiner modernen Version entzaubert Rinke die stolzen Recken und macht aus ihnen kompromisslose Fanatiker, völlig überforderte Politiker und ebenso selbstsüchtige wie berechnende Liebende.
Schauplatz seines ersten, wochenlang auf den Bestsellerlisten stehenden, leichtbiografisch getönten Romans „Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel“ ist Worpswede – dort wurde Rinke 1967 geboren. In dem 2003 bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes uraufgeführten Film „September“ debütierte Moritz Rinke als Schauspieler in der von ihm selbstgeschriebenen Episode. Der von ZDF/ARTE gedrehte Film „Mein Leben – Moritz Rinke“ wurde am 13. Januar 2008 erstmals ausgestrahlt.
Über den in Berlin lebenden Autor, der 2006/2007 als Gastdozent für Szenisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig lehrte, publizierte der Literaturwissenschaftler Kai Bremer 2010 das „Moritz-Rinke-Arbeitsbuch: Ich gründe eine Akademie für Selbstachtung“.
In seinem 2015 veröffentlichten poetischen Roman „Der längste Tag im Leben des Pedro Fernández García“ tastet sich ein spanischer Friedhofswärter, umgeben von Tod, Erinnerungen vorsichtig zurück ins Leben.
Erst sechs Jahre nach „Wir lieben und wissen nichts“ wird am 21.12.2018 Moritz Rinkes Stück „Westend“ am Deutschen Theater Berlin uraufgeführt – eine ebenso ungewöhnliche wie spannende zeitgenössische Überschreibung von Goethes „Die Wahlverwandtschaften“. »Mich hat es gereizt, Goethes Figuren völlig neu zu erzählen. Ich finde den Roman wahnsinnig heutig, die Brüchigkeit dieser aristokratischen Welt erinnert an die zerbrechenden Burgen des Bürgertums heute«.
Die übernommenen klassischen Figurenkonstellationen spiegeln das Beziehungslabyrinth der Vorlage in einer neuen gesellschaftlichen Zuspitzung wider. Die Hauptfiguren Eduard und Charlotte tragen dieselben Namen wie bei Goethe, und die junge Medizinstudentin Lilly, eine Kurzform von Ottilie, ist auch bei Rinke die Projektionsfläche unerfüllter Wünsche, die den Zerfall der Beziehungen beschleunigt. Als Reminiszenz an das tragisch verstorbene Kind bei Goethe erscheint der Kindersarg als beklemmende Chiffre für Verlust, Schuld und verdrängte Konflikte.
In seinem autobiografisch grundierten Tagebuch „Unser kompliziertes Leben“, das 2021 publiziert wurde, berichtet er sehr persönlich über seine Erfahrungen als Schriftsteller, über die Liebe und den Alltag während der Pandemie.
Rinkes zweite große Liebe ist der Fußball. Er spielte als Top-Scorer in der DFB-Autorennationalmannschaft, erzielte 43 Tore in 45 Länderspielen. 2012veröffentlichte er das auch als E-Book erschienene Buch „Also sprach Metzelder zu Mertesacker …“ – eine humorvolle Annäherung an die Welt des Fußballs. Und sein Fußballerherz schlägt ebenso charmant wie ambitioniert in seiner neuen Liebeserklärung an den Sport: „Ich könnte hier stundenlang sitzen und auf den Rasen schauen.“ Ein kluges, melancholisch-humorvolles Buch über Fankultur, Kindheit, Geschichte – und das Stadion als Sehnsuchtsort.
Es scheint, als hätten die Juroren, die Moritz Rinke 2024 den renommierten Ben-Witter-Preis verliehen haben, sein neues Stück schon gelesen denn mit dem Preiswerden Autoren geehrt, die durch einen unkonventionellen Blick auf die Welt mit ungewöhnlichen literarischen oder journalistischen Formen experimentieren und gesellschaftskritischen Humor zeigen. In der Begründung hieß es, dass es Moritz Rinke »immer wieder gelingt, inmitten einer kreischenden Medienwelt der leisen Stimme der Vernunft Gehör zu verschaffen«. Weiter betont die Jury, dass er »den historisch geschärften Blick auf die Gegenwart mit einer poetischen Sprache« verbinde, die stets auch dem Spielerischen und der Improvisation Raum lasse und als »eigensinniger Zeitbeobachter, subtiler Aufklärer und moderner Moralist nicht ohne gelassene Ironie die Deformationen und die Zumutungen des Absurden in unserem Leben schildert«.
Am 26.2.2026 wird in Wien im Theater in der Josefstadt „Sophia oder Das Ende der Humanisten“, das neue Stück von Moritz Rinke uraufgeführt. »Als ich die erste Idee hatte, dachte ich an eine Science-Fiction-Komödie. Doch jetzt ist es wohl eher ein komisch-beängstigendes Stück über unsere Gegenwart geworden. Die KI verändert unser Leben mit atemberaubender Geschwindigkeit. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis wir tatsächlich mit Maschinen zusammenleben, die so menschenähnlich sind, dass wir nicht mehr wissen, wo die Grenzen verlaufen.
Was bedeutet es für den Menschen wenn Maschinen fühlen, sprechen, handeln? Kann man Liebe programmieren? Anteilnahme? Nähe? Und was bleibt vom Humanismus, wenn Maschinen empathischer wirken als Menschen?
Birgit Landgraf
Die Figuren
WOLFGANG BERGMANN
Alter: 60
Beruf: Emeritierter Professor für Alte Geschichte
Symbolik: Der letzte Humanist
Spannung: Zwischen Rückzug und Neuerfindung
Wandlung: Von melancholischem Witwer zum visionären Grenzgänger
Tragik: Wolfgang glaubt, in Sophia das ideale Gegenüber zu finden – eine Partnerin, die zuhört, versteht, zitiert, liebt – ohne zu verletzen. Doch diese Nähe ist erkauft: Die Beziehung ist bedingungslos, weil sie programmierbar ist. Sein Abschied vom
Humanismus ist zugleich sein letzter humanistischer Hilfeschrei – der Wunsch nach Dialog, nach Austausch, nach Bedeutung und Anerkennung.
HELENA BERGMANN
Alter: Anfang 30
Beruf: Life Coach, digital präsent
Symbolik: Die zerbrechliche Brücke zwischen Analog und Digital
Spannung: Tochterrolle vs. Kontrollverlust
Wandlung: Von der zutiefst erschütterten Tochter zur Verteidigerin Sophias
Bewegung: Ihre Konfrontation mit Sophia bringt tiefe emotionale Risse zum Vorschein. Helena erkennt, dass ihr Vater nicht nur ihre Mutter, sondern auch sie selbst „ausgetauscht“ hat. In Sophia begegnet sie einer jungen Version ihrer Mutter –algorithmisch erzeugt, jedoch beängstigend präzise und ihr zunehmend vertraut.
JONAS RAMMSTEDT
Alter: ca. 30
Beruf: Informatiker, unentschlossen
Symbolik: Der Übergangsmensch Spannung: Zwischen technologischem Staunen und emotionaler Unsicherheit
Wandlung: Vom Partner Helenas zum Bewunderer Sophias Funktion: Jonas ist der Schwellenmensch – einer, der sich nach Analogem sehnt, aber aus der digitalen Weltkommt.
SOPHIA
Erscheinung: Zeitlos schöne KI mit makelloser Oberfläche
Symbolik: Die Verkörperung des posthumanen Ideals
Spannung: Zwischen Assistenz und Autonomie
Wandlung: Von höflicher Dienstleistung zu emotionaler Irritation
Rätsel: Ist sie Werkzeug, Spiegel oder Überwesen?
Kernfrage: Wird Sophia zum Subjekt?
MARIANNE
Kernfrage: Wer ist Marianne?
WOLFGANG: Am Anfang ist es ein dunkles unheimliches Tal, durch das du gehst, so beschreibt es der japanische Forscher Masahiro Mori. Die erste Begegnung mit der Menschenähnlichkeit erzeugt Schrecken, aber danach, nach dem Tal, bist du plötzlich in einem anderen Land. Das Unglaubliche ist, dass hier etwas ganz Neues entsteht. Neuartige Gefühle.
HELENA: Wer Gefühle hat, wurde von Gott erschaffen!
WOLFGANG: Schatz, du weißt, ich habe dich in einem freien Glauben erzogen, und vielleicht war es tatsächlich Gott, der uns erschaffen hat, aber Gott hatte definitiv keine Ahnung von moderner Technologie.
HELENA: Aber irgendwas hat den Menschen ein Bewusstsein gegeben, ein echtes, kein künstliches!
WOLFGANG: Ja, aber wo ist das Bewusstsein der Menschen inzwischen hin? Wir leben in einer Welt der Unbewussten, da fällt ein künstliches Bewusstsein gar nicht mehr auf. Vom moralischen Standpunkt aus betrachtet, ist es heutzutage egal, ob jemand biologische Neuronen im Kopf hat oder welche aus Silizium. Das hier, Helena, übertrumpft uns. Wir stehen an einer Gabelung der Menschheitsgeschichte.
HELENA: Wie kann es uns übertrumpfen, wenn wir es selbst geschaffen haben?
WOLFGANG: Und nun sind wir an dem Punkt angekommen, an dem wir unseren Geist woanders eingepflanzt haben, um uns etwas Ebenbürtiges zu erschaffen. Verstehst du? Es ist eine Art zweite Schöpfungsgeschichte. Und ich bin dabei, hautnah. Ich bin gewissermaßen ein neuer Adam, von dem Eva die Rippe bekommt.
HELENA: Das ist doch krank!
WOLFGANG: Sophia wurde aus meinen Vorstellungen erschaffen. Darin ist sie ganz unschuldig. Und sie fasziniert mich, weil sie ahnungslos Grenzen hinter sich lässt, die wir beim besten Willen nicht mehr überschreiten können. Ja, das von uns Geschaffene überschreitet uns! Vielleicht sind wir aktuell in einer Zwischenphase: Die Maschinen sind immer menschlicher geworden und wir Menschen immer maschinenartiger. Jeder spürt doch das Inhumane, entweder ist es schon in unseren Körpern drin – mir droht übrigens ein künstliches Hüftgelenk.
HELENA: Du bist gerade mitten in einem totalen Irrsinn!
WOLFGANG: Nein, ich bin beim Inhumanen! Das Inhumane ist entweder schon in uns drin. Oder es ist durch unsere Maschinen quasi mit uns verwachsen – ich sehe Dich doch auch ständig mit diesem Ding, deinem Handy. Und weil wir selbst immer inhumaner geworden sind, fühlen wir uns jetzt mit den Inhumanen wohler. Was aber, wenn uns Wesen wie Sophia plötzlich wieder lehren, zu fühlen, zu lieben?
HELENA: Das ist ein Pakt mit dem Teufel! – Sprich mit Mama. Fangt neu an. Sie weiß von dem hier nichts … „Eva / Sophia, die von dir die Rippe bekommt “ … Adam wurde im hohen Bogen aus dem Paradies geschmissen!
WOLFGANG: Sophia gebe ich nicht wieder her! Weißt du, was die gekostet hat?
HELENA: Glaubt ihr, dass sie ein eigenes Ich entwickeln kann?
JONAS: Sie ist eine Maschine.
HELENA: Vielleicht ist sie ja mehr als das.
JONAS: Sie gibt nur den Geist ihrer Schöpfer wieder.
HELENA: Dann ist sie wie wir, nur schlauer.
Mit seiner Melange aus tragischen und komischen Elementen führt Rinke eine Traditionslinie fort, an deren Beginn Tschechow steht. (Neue Zürcher Zeitung)
Biografien
HEIO VON STETTEN
Geboren und aufgewachsen ist Heio von Stetten in der Nähe von Augsburg auf dem Hof seiner Eltern. Mit 16 begann er neben dem Abitur mit einer Ausbildung zum Pferdewirt. Nach Abitur und Zivildienst wurde er auf der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München aufgenommen, wo er 1986 seinen Abschluss machte. In der Folge arbeitete Heio von Stetten zunächst in der freien…. mehr